Juli Ausgabe. HATTENhat. im Gespräch mit Sven Steinbeck - Malteser Sandkrug
- HATTENhat. Redaktion
- 26. Juli 2025
- 11 Min. Lesezeit


In dieser Ausgabe von HATTENhat. im Gespräch freuen wir uns, eine Persönlichkeit vorzustellen, die sich seit über drei Jahrzehnten in Hatten und weit darüber hinaus für das Gemeinwohl einsetzt: Sven Steinbeck, Leiter der Einsatzdienste bei den Maltesern Sandkrug.
Seit seinem Eintritt 1991 als Sanitätshelfer hat Herr Steinbeck zahlreiche Rollen übernommen, vom Gruppenführer über den Leiter der Schnelleinsatzgruppe (SEG) bis hin zum Verbandsführer bei Katastropheneinsätzen. Seine Einsätze führten ihn zu Hochwasserkatastrophen, zur Flüchtlingshilfe, in den Corona Krisenstab und sogar zum Papstbesuch 2011.
Doch hinter all dem Engagement steckt ein Mensch mit Herz, Führungsstärke und tiefer Motivation für das Ehrenamt.
Wir haben Herrn Steinbeck gefragt, was ihn antreibt und was ihn in all den Jahren bewegt hat.
Herr Steinbeck, seit über 30 Jahren sind Sie bei den Maltesern aktiv.
Können Sie sich noch an Ihren allerersten Einsatz erinnern und was dieser für Sie bedeutet hat?
S.S.: Ja, an meinen allerersten Einsatz kann ich mich noch gut erinnern – er hat sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt. Mein Weg bei den Maltesern begann im Ehrenamt, später absolvierte ich die Ausbildung zum Sanitätshelfer. Zu Beginn durfte ich dann gemeinsam mit zwei erfahrenen Kollegen auf Einsatzfahrt gehen: Ralf Düßmann und Dietmar B. – letzterer ist leider inzwischen verstorben. Beide waren etwa Anfang 30, aber schon echte Routiniers im Rettungsdienst. Man musste mit ihnen zurechtkommen, und wenn man das geschafft hatte, wusste man: Man ist auf dem richtigen Weg.
An meinem allerersten Tag hatten wir morgens einen Verkehrsunfall mit Hubschraubereinsatz, später folgte ein weiterer Unfall in Neerstedt mit mehreren Verletzten – darunter auch ein Fall, bei dem eine Reanimation notwendig war. Die Kollegen haben mich dann auch das Einsatzfahrzeug überprüfen lassen. Dabei ist mir beim Herausziehen einer Schublade der komplette Inhalt zu Boden gefallen. Ich erinnere mich noch gut an den Satz, den man mir damals sagte: „Das machst du genau einmal – jetzt weißt du, wie’s geht.“
Ich habe mich an diesem Tag gefragt, ob der Rettungsdienst immer so abläuft. Die Antwort war ein kurzer Blick der Kollegen und ein einfaches: „Nein.“ Damals war die Einsatzlage noch überschaubar – vielleicht vier bis fünf Fahrten pro Woche. Heute ist das deutlich mehr. Dass ich an meinem ersten Tag gleich ein so breites Spektrum an Einsätzen erleben durfte, war außergewöhnlich – aber offenbar habe ich mich bewährt. Man hat mich jedenfalls nicht gleich wieder nach Hause geschickt.
1993 haben Sie die Schnelleinsatzgruppe Sandkrug mit aufgebaut.
Wie sah die Arbeit damals aus – und was hat sich seither grundlegend verändert?
S.S.: Als wir 1993 die Schnelleinsatzgruppe in Sandkrug aufgebaut haben, war die Struktur noch eine ganz andere als heute. Damals bestand das Team hauptsächlich aus Zivildienstleistenden – wir hatten zwei Ehrenamtliche und etwa vierzehn Zivildienstleistende, die im täglichen Einsatzgeschehen eine tragende Rolle spielten. Auf sie konnte man jederzeit zurückgreifen, insbesondere tagsüber.
Heute hat sich das grundlegend verändert: Die Zivildienstzeit ist Vergangenheit, und wir arbeiten mittlerweile mit deutlich mehr ehrenamtlichen Kräften. Diese stehen jedoch aufgrund ihrer regulären Berufe tagsüber oft nicht zur Verfügung, was die Einsatzplanung erheblich erschwert.
Besonders deutlich wird der Wandel im Bereich der Rettungswageneinsätze. Einen solchen heute zu besetzen, ist eine große Herausforderung – denn dafür braucht es ausgebildete Notfallsanitäter. Das Ausbildungssystem war früher deutlich besser organisiert: Die Kosten wurden übernommen, und der Zugang war einfacher. Heute hingegen müssen Organisationen oder die Auszubildenden selbst die Ausbildung finanzieren, die rund drei Jahre dauert und mit hohen Kosten verbunden ist – fast im sechsstelligen Bereich. Für Ehrenamtliche ist das kaum zu stemmen, es sei denn, sie verfügen über außergewöhnlich viel Zeit und finanzielle Mittel.
Auf der technischen Seite hingegen haben sich die Rahmenbedingungen klar verbessert. Damals war das eingesetzte Equipment wesentlich einfacher, sowohl im Hinblick auf die medizinische Ausstattung als auch auf die Einsatzfahrzeuge. Wenn man heutige Rettungswagen mit denen von damals vergleicht, liegen Welten dazwischen. Ich habe kürzlich ein altes Foto herausgesucht – es macht sehr deutlich, wie weit wir seither gekommen sind. Die Entwicklung der Technik ist ohne Zweifel ein großer Fortschritt.

Sie haben im Laufe der Jahre viele Einsätze geleitet vom Elbehochwasser bis hin zum Papstbesuch 2011.
Gibt es einen Moment, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
S.S.: Ein Einsatz, der mir bis heute besonders im Gedächtnis geblieben ist, fand im September 2011 während des Papstbesuchs in Etzelsbach bei Erfurt statt. Ich war dort als Abschnittsleiter für einen Bereich mit rund 65.000 Menschen verantwortlich – darunter ein provisorisch errichteter Bahnhof, der schließlich als einziger für den Abtransport der Besucher offenblieb.
Nach dem Ende der Veranstaltung strömten plötzlich rund 16.000 bis 17.000 Menschen gleichzeitig in Richtung dieses Bahnhofs. Der vorgesehene Ablauf – die Besucher sollten zunächst auf einem Parkplatz mit Verpflegungspunkten „gepuffert“ und dann in Gruppen zu 200 Personen zum Bahnsteig geführt werden – wurde durch eine nicht abgestimmte Maßnahme eines Sicherheitsmitarbeiters unterbrochen: Ein Absperrzaun wurde geöffnet, sodass die Menschen unkontrolliert einen steilen, schlecht beleuchteten Waldweg hinabströmten – ein Bereich, der weder für große Menschenmengen noch für einen sicheren Ablauf geeignet war.
Die Situation eskalierte schnell. Es kam zu ersten medizinischen Notfällen, Menschen kollabierten, und es drohte Panik – ein Szenario, das stark an die Loveparade-Katastrophe von 2010 erinnerte. Inmitten unklarer Zuständigkeiten zwischen Landes- und Bundespolizei übernahm ich die Koordination, forderte zusätzliche Einsatzfahrzeuge an und setzte schließlich durch, dass der ursprüngliche Ablauf wieder eingehalten wurde. Letztlich konnten alle Menschen sicher und ohne schwere Zwischenfälle abtransportiert werden.
Trotz des enormen Drucks war dieser Einsatz ein Beispiel dafür, wie wichtig klare Kommunikation, schnelle Entscheidungen und das Vertrauen in ein funktionierendes Team sind. Die Anerkennung, die ich im Anschluss von den Einsatzkräften, der Polizei und später auch innerhalb der Malteserorganisation erhielt, war für mich persönlich ein bewegender Moment – und eine Bestätigung, dass sich jahrelanges Engagement lohnt.
Die SEG Sandkrug zählt heute rund 30 ehrenamtliche Mitglieder.
Wie gelingt es Ihnen, diese Menschen langfristig zu motivieren – trotz wachsender Belastungen im Ehrenamt?
S.S.: Die langfristige Motivation ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer ist angesichts wachsender Anforderungen eine große Herausforderung. In den Anfangsjahren war die Situation noch eine andere: Zivildienstleistende prägten den Alltag. Heute basiert das Engagement auf echter Überzeugung. Viele kommen mit dem Wunsch, im Sanitätsdienst aktiv zu werden, und bringen bereits ein hohes Maß an Eigenmotivation mit.
Unsere Aufgabe ist es, diese Menschen zu begleiten und bestmöglich zu unterstützen. Dazu gehört vor allem eine qualifizierte Ausbildung, die wir in Kooperation mit der Malteser-Schule in Vechta anbieten. Dort übernehmen pädagogisch geschulte Fachkräfte die theoretische Ausbildung, während wir uns auf die praktische Begleitung konzentrieren – ein zeit- und kostenintensiver Prozess. Nicht jeder bleibt langfristig dabei: Manche stellen nach dem ersten Einsatz fest, dass die Belastung doch zu hoch ist.
Wichtige Voraussetzungen für das Ehrenamt sind Eigenverantwortung, Zuverlässigkeit, Mut und ein gewisses Maß an Opferbereitschaft – denn Freizeit muss man für dieses Engagement ganz bewusst aufgeben. Wir versuchen, durch gute Ausrüstung, transparente Kommunikation und das Ernstnehmen von Sorgen und Wünschen Wertschätzung zu zeigen.
Die Realität im Einsatz ist fordernd: Unsere Helfer stehen nicht in der zweiten Reihe – sie sind mittendrin. Ob Verkehrsunfall, Großschadenslage oder Feuer in einer Pflegeeinrichtung – hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Umso wichtiger ist es, auch psychologisch zu begleiten. Deshalb arbeiten wir eng mit einer Psychologin aus der Jugendpsychiatrie zusammen, um Überforderung zu vermeiden.
Wir richten unseren Blick zunehmend auch auf neue Zielgruppen: Menschen ab 45 Jahren, die sich noch einmal einer sinnstiftenden Aufgabe stellen möchten, sowie Jugendliche ab 16, die wir behutsam an die Arbeit heranführen. Unser Ziel ist es, Menschen für die Idee der Malteser zu begeistern – nicht als „Rettungshelden“, sondern als engagierte Mitbürger, die Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen möchten.
In Deutschland engagieren sich rund 29 Millionen Menschen freiwillig (BMI). Gleichzeitig wird es für viele Organisationen immer schwieriger, Nachwuchs zu gewinnen.
Wie erleben Sie diese Entwicklung ganz konkret in Ihrer Einheit?
S.S.: Das freiwillige Engagement steht in Deutschland grundsätzlich auf einer soliden Basis – rund 29 Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Dennoch spüren auch wir ganz konkret, wie schwierig es geworden ist, neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu gewinnen. Unsere Einheit gehört zu den vier großen Organisationen im Bereich der Gefahrenabwehr – neben der Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz und anderen. Besonders die Feuerwehr ist traditionell stark aufgestellt, aber auch wir leisten einen wichtigen Beitrag.
Aktuell sprechen wir gezielt Menschen im Alter zwischen 45 und 50 Jahren an – eine Altersgruppe, die häufig offen für neue Herausforderungen ist. Allerdings braucht es ein gewisses Maß an Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Denn der Einsatzdienst beginnt nicht erst mit dem Alarm: Vorbereitung ist alles. Dazu gehört, dass das Material regelmäßig überprüft wird, Fahrzeuge einsatzbereit sind und man sich persönlich Zeit für Ausbildung und Übungsdienste nimmt. Je mehr Ehrenamtliche sich beteiligen, desto mehr lässt sich realisieren.
Ein zentrales Thema ist auch die Nachwuchsförderung. Junge Menschen müssen ermutigt werden, sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Ich selbst habe das erlebt: Während meiner Ausbildung in der Kälte- und Klimatechnik hatte ich einen Chef, der mein Engagement bei den Maltesern aktiv unterstützte. Als ich einmal in Berlin war und am Abend Dienst hatte, überließ er mir kurzerhand seinen Autoschlüssel mit den Worten: „Du musst rechtzeitig zur Wache, dann fahr los.“ Diese Haltung war für mich prägend – denn wenn Führungskräfte das Ehrenamt ernst nehmen und mittragen, entstehen oft langjährige Bindungen. Viele engagieren sich dann nicht nur kurzfristig, sondern über Jahrzehnte hinweg.
Kurzum: Motivation entsteht nicht nur im Inneren, sondern auch im sozialen Umfeld – besonders am Arbeitsplatz. Ein verständnisvoller Arbeitgeber kann entscheidend dazu beitragen, dass Ehrenamt gelingt und wächst.
2012 haben Sie die Qualifikation zum Notfallsanitäter abgeschlossen.
Welche fachlichen und menschlichen Fähigkeiten sind heute wichtiger denn je in Ihrer Rolle?
S.S.: Die Qualifikation habe ich im Jahr 2012 abgeschlossen – doch der Lernprozess im Rettungsdienst endet nie. Die Anforderungen entwickeln sich ständig weiter. Heute umfasst die Ausbildung zum Notfallsanitäter in der Regel drei bis dreieinhalb Jahre und ist eine anspruchsvolle Vollzeitausbildung. Schon vom ersten Tag an werden die Auszubildenden intensiv begleitet. Ein Quereinstieg ist zwar möglich, aber Vorkenntnisse – etwa durch eine vorherige Ausbildung oder das Abitur – sind von großem Vorteil.
Ich selbst habe eine sogenannte „Treppenausbildung“ durchlaufen: vom Einsatzsanitäter über den Rettungshelfer und -sanitäter bis hin zum Rettungsassistenten – damals noch eine zweijährige Berufsausbildung –, bevor ich schließlich Notfallsanitäter wurde. Heute ist die dreijährige Ausbildung Voraussetzung für diese Qualifikation. Damit gehen mehr Verantwortung und umfassendere Kompetenzen einher.
Neben der Grundausbildung sind regelmäßige Fortbildungen unerlässlich – mindestens 30 Stunden jährlich. Diese erfolgen teils online, teils durch praxisnahe Schulungen wie die sogenannten ABC-Kurse. Ziel ist es, medizinisch immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, Richtlinien, Algorithmen und Medikamentenstandards sicher zu beherrschen.
In den letzten Jahren hat der Rettungsdienst zunehmend Aufgaben übernommen, um die Belastung von Notärzten zu reduzieren. Dennoch ist der Notarzt unverzichtbar, vor allem bei komplexen medizinischen Fällen – allein schon aufgrund seiner spezialisierten Ausbildung und klinischen Erfahrung.
Besonders im ländlichen Raum stehen wir vor Herausforderungen: Die medizinische Versorgung darf nicht unter den Abbau von Strukturen leiden. Es kann nicht sein, dass Patienten in der Stadt besser versorgt sind, obwohl die Krankenkassenbeiträge identisch sind. Die Wege zum Arzt sind hier deutlich länger – das muss politisch mitbedacht werden.
Ein weiterer Aspekt ist die Zukunft der älteren Mitarbeiter im Rettungsdienst. Es ist realitätsfern zu erwarten, dass man bis zum 67. Lebensjahr unter hoher körperlicher und psychischer Belastung Nachtschichten leisten kann. Hier sind kreative Lösungen gefragt – sei es durch flexiblere Einsatzmodelle oder ein früheres Renteneintrittsalter. Erfahrung darf nicht verloren gehen, sie muss gezielt eingebunden werden.
Sie haben viele Krisensituationen hautnah erlebt – zuletzt auch während der Corona-Pandemie.
Wie verarbeiten Sie persönlich Einsätze, die emotional besonders belastend sind?
S.S.: Krisensituationen wie die Corona-Pandemie oder die Aufnahme geflüchteter Menschen stellen Einsatzkräfte vor besondere Herausforderungen – auch emotional.
Während der Pandemie war vieles ungewiss: Wie gefährlich ist das Virus? Wie schützt man sich selbst und andere? Als Einsatzkraft musste ich weiter zur Arbeit, obwohl die Risiken noch kaum einschätzbar waren.
Besonders beeindruckt haben mich in dieser Zeit unsere Auszubildenden, die großen Mut gezeigt haben. Einer sagte bei einem eindeutig infektiösen Patienten zu mir: „Du hast Familie – ich übernehme das, denn wenn ich erkranke, ist das weniger dramatisch.“ Solche Momente vergisst man nicht.
In akuten Lagen, etwa beim Aufbau von Flüchtlingsunterkünften, zählt vor allem schnelles Handeln. Meine Aufgabe ist es, in der Anfangsphase Strukturen zu schaffen – medizinische Erstversorgung sicherzustellen, Personal zu koordinieren, Abläufe zu organisieren. Oft begegnet man dabei auch Situationen, auf die man nicht vorbereitet ist: ein krankes Kind, fehlende Medikamente oder auch Spannungen im Umfeld. Manchmal geht es dann auch darum, kleine Dinge zu tun, die große Wirkung haben – wie Müll aufzusammeln, um Vorurteile zu entkräften, oder eine Hebamme zu organisieren.
Solche Einsätze fordern einen mental, doch ich verarbeite sie, indem ich mich auf das Wesentliche konzentriere: helfen, Verantwortung übernehmen und Lösungen finden – mit Empathie, Pragmatismus und Teamgeist.
Viele Bürgerinnen und Bürger sehen die Einsatzkräfte nur am Rande – auf Veranstaltungen oder bei Katastrophen.
Welche unterschätzte Arbeit passiert im Hintergrund, die kaum jemand mitbekommt?
S.S.: Viele Bürgerinnen und Bürger nehmen die Malteser vor allem bei Großveranstaltungen, Notfällen oder Katastrophen wahr – doch ein Großteil unserer Arbeit geschieht im Verborgenen. Und genau das ist Teil des Problems: Wir agieren bewusst im Hintergrund, leise, pragmatisch und mit einem hohen Maß an Improvisationsfähigkeit. Während andere Organisationen lautstark ihre Anliegen vertreten und genau wissen, auf welcher rechtlichen Grundlage sie Forderungen stellen können, halten wir uns oft zurück.
Auch nach außen hin wirken wir oft unauffällig. Wer etwa an unserer Dienststelle vorbeifährt, wird kaum bemerken, dass sich hier ein engagiertes Einsatzteam befindet – ein großes, sichtbares Schild sucht man vergebens. Dabei ist die alltägliche Arbeit, die im Hintergrund geleistet wird, enorm umfangreich: Organisation, Schulung, Vorbereitung auf verschiedenste Einsatzszenarien und nicht zuletzt der Umgang mit sehr unterschiedlichen Menschen, die wir bei Veranstaltungen betreuen oder denen wir im Notfall begegnen.
Dafür haben wir Lösungen: durch gezielte Ausbildung, durch klare Strukturen und durch ein einheitliches Auftreten. Die Einheitskleidung etwa hilft, soziale Unterschiede auszugleichen und sorgt für Disziplin im Team. Unsere Einsatzkräfte kommen nicht in Alltagskleidung zum Dienst – das stärkt das Gemeinschaftsgefühl und die Professionalität.
Hinzu kommt ein kontinuierlicher Ausbildungsprozess: Jeder muss regelmäßig Prüfungen ablegen – schriftlich, mündlich und praktisch. Diese ständige Wiederholung und Überprüfung der Grundlagen sorgt nicht nur für fachliche Sicherheit, sondern erdet auch. Die Gruppe formt sich selbst – durch gegenseitiges Achten, durch gemeinsames Lernen und durch gelebte Verantwortung füreinander.
Gab es im Laufe Ihrer Tätigkeit ein Erlebnis – eine Begegnung, ein Dank, eine kleine Geste das Sie bis heute besonders berührt hat?
S.S.: Ja, im Laufe der Jahre gab es einige besondere Momente, kleine Gesten der Dankbarkeit, die oft mehr sagen als große Worte. Besonders berührt hat mich der Dankesbrief eines etwa sechsjährigen Jungen, dem wir nach einem Armbruch geholfen hatten. Er hatte den Brief ganz allein "geschrieben" und in mein Fach auf der Wache gelegt. Ich habe mich sehr darüber gefreut.
Aber auch im Alltag erfahren wir immer wieder Wertschätzung. Gerade bei schlechtem Wetter – wenn der Dienst besonders herausfordernd ist – bringen uns Menschen aus der Gemeinde Kuchen vorbei. Eine Frau fällt mir dabei besonders ein: Sie backt regelmäßig sechs oder sieben Torten auf einmal und bringt sie zu uns. Zu Weihnachten überrascht sie uns jedes Jahr mit einem großen Präsentkorb, gefüllt mit vielen Leckereien. Und sie ist nicht die Einzige – auch andere Menschen zeigen uns auf ihre Weise, dass sie unsere Arbeit sehen und schätzen.
Gerade während der Corona-Pandemie haben uns viele Bürger durch kleine Gesten gezeigt, dass sie hinter uns stehen. Solche Erlebnisse geben Kraft – und sie sind es, die einem im Gedächtnis bleiben.
Wenn Sie heute jungen Menschen einen Rat geben könnten, die überlegen, sich ehrenamtlich zu engagieren: Was würden Sie ihnen sagen – und was wünschen Sie sich von der Gesellschaft als Unterstützung für das Ehrenamt?
S.S.: Junge Menschen für ein Ehrenamt zu begeistern, ist heute ebenso wichtig wie herausfordernd. Entscheidend ist dabei vor allem die Anerkennung – nicht nur von außen, sondern auch aus dem eigenen Umfeld. Wenn Familie und Arbeitgeber die ehrenamtliche Tätigkeit wertschätzen und aktiv unterstützen, entsteht eine ganz andere Motivation. Gerade Arbeitgeber können hier einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie Freiräume schaffen und Verantwortung mittragen.
Ich selbst habe in jungen Jahren vor einer grundlegenden Entscheidung gestanden: Zivildienst im Rettungswesen oder Wehrdienst? Damals herrschte noch Wehrpflicht. Mein Großvater, selbst Soldat und Kriegsveteran, stand voll hinter mir – obwohl er Schlimmes erlebt hatte und aus Russland nur mit wenigen Kameraden zurückkehrte. Er sagte: „Der Junge soll das machen, was er für richtig hält.“ Diese Rückendeckung war für mich entscheidend. Die Bundeswehr versuchte mich dennoch zu verpflichten, insbesondere als Sanitäter. Ich musste viele Briefe schreiben, persönlich vorsprechen und für meinen Weg kämpfen. Letztlich bekam ich die Zustimmung, meinen Dienst im Rettungswesen zu leisten – ein prägendes Erlebnis, das mir zeigte, wie wichtig persönliche Überzeugung und Unterstützung sind.
Heute bieten die Malteser eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren: vom Besuchsdienst über Einkaufs- und Fahrdienste bis hin zum Hausnotruf. Jede und jeder – unabhängig vom Alter – kann einen Beitrag leisten. Es gibt keine „kleinen“ Aufgaben, alles ist wertvoll und notwendig. Natürlich leben wir auch vom hauptamtlichen Engagement, aber ohne die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer wäre unsere Arbeit nicht möglich. Der gesellschaftliche Bedarf an unterstützenden Dienstleistungen wächst stetig – und das Ehrenamt ist dabei unverzichtbar.
Ich wünsche mir von der Gesellschaft, dass sie diesem Engagement mit noch mehr Respekt, Aufmerksamkeit und konkreter Unterstützung begegnet. Und für alle, die wenig Zeit haben: Auch finanzielle Hilfe ist ein wertvoller Beitrag. Jeder kann etwas tun – auf seine Weise. Es kommt darauf an, Verantwortung zu übernehmen und solidarisch zu handeln.
---
Wir möchten uns ganz herzlich bei Herrn Steinbeck, Leiter der Einsatzdienste bei den Maltesern Sandkrug, für seine Zeit und Offenheit bedanken. Besonders bedanken wir uns dafür, dass er uns die Türen der Malteser geöffnet und uns so einen authentischen Blick hinter die Kulissen ermöglicht hat – inklusive der Möglichkeit, die Besichtigung fotografisch zu dokumentieren.
Wir sehen hier, was Gemeinschaft und freiwilliges Engagement in unserer Gemeinde wirklich bewirken können, bedanken uns im Namen aller, die sich in Hatten für andere einsetzen – und hoffen, dass dieses Beispiel viele inspiriert, sich ebenfalls einzubringen.
Für HATTENhat. bedeutet dieses Interview weit mehr als eine reine Berichterstattung: Es ist Ausdruck unserer Philosophie, in der soziales Engagement, Gemeinschaft und gelebte Nachbarschaft zentrale Werte sind. In unserem Blog – ebenso wie auf der Plattform mit zahlreichen sozialen Projekten aus Hatten – stehen genau diese Themen im Fokus
Bleiben Sie dran, für weitere inspirierende Gespräche, regelmässig am letzten Sonntag des Monats, in unserer Reihe HATTENhat. im Gespräch.
HATTENhat.
Weil wir Hatten leben !
Von Hatten für Hatten
✨ Entdecken Sie die Kraft sozialer Projekte in Hatten!
Unser Besuch bei der Maltesern in Sandkrug
📸 Bilder: Andres Vanegas - OSO Media










































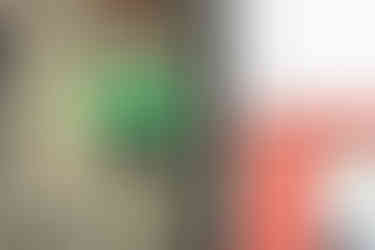
















Kommentare